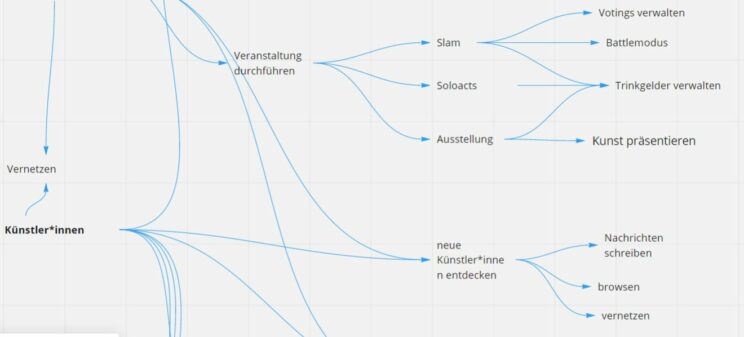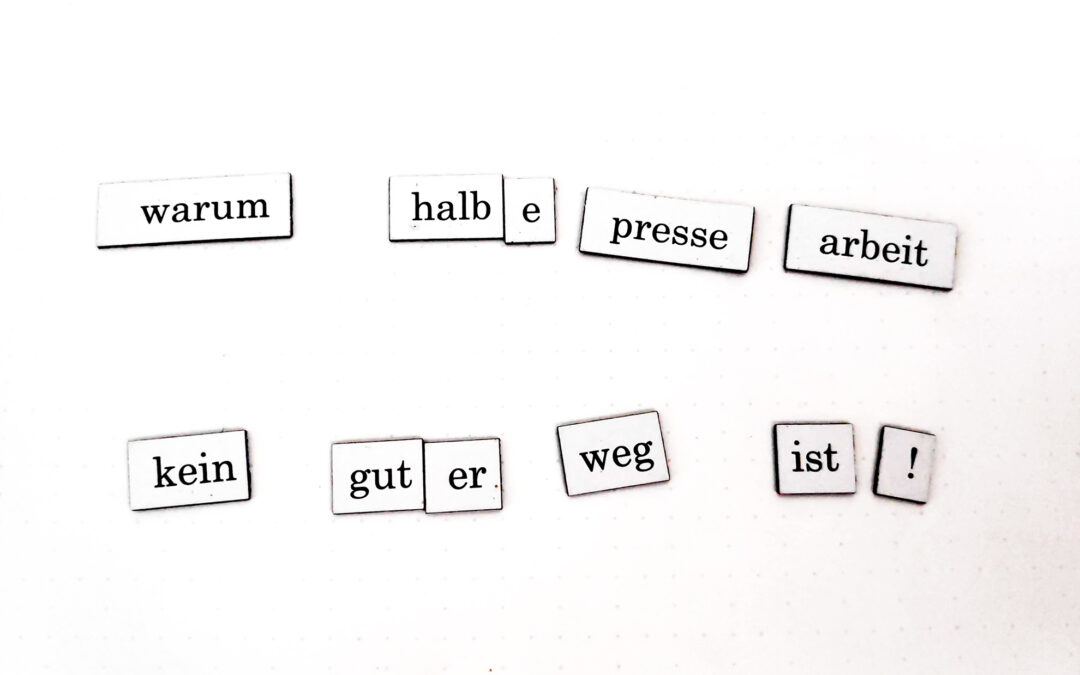Wir müssen reden – ein besonderes Selbsthilfeprojekt
Vor drei Jahren durfte ich helfen, ein besonderes journalistisches Projekt auf die Beine zu stellen: „Wir müssen reden!“, eine Themenwelt des Magazins move36, die junge Selbsthilfe in den Fokus nahm. Entstanden ist die Idee aus der Kooperation des Fuldaer Magazins mit der Barmer und dem Selbsthilfebüro Osthessen. Dieser Tage wird das Projekt abgeschlossen. move36 hat darüber einen wunderbaren Rückblick geschrieben.
Ich möchte Menschen eine Stimme verleihen, die etwas zu erzählen haben, aber nicht die richtigen Worte finden. Mit diesem Ziel habe ich vor inzwischen über 15 Jahren meinen Weg in den Journalismus eingeschlagen. Mich interessierten immer die Geschichten, die andere übersehen. Das reale Leben, der Alltag, die Menschen, die sich für andere einsetzen. In Redaktionskonferenzen habe ich öfter mal den Kommentar geerntet: „Och Mariana, schon wieder so ein schweres, so ein ernstes Thema.“ Als mein damaliger Chefredakteur bei move36 also auf mich zukam und mir vorschlug, eine Themenwelt zu Selbsthilfe in unserem Jugendmagazin zu machen, wusste ich sofort: Das ist genau meine Welt.
Selbsthilfethemen für junge Leser aufzubereiten, ist nicht einfach. Geschichten über Schicksale, Erkrankungen, seelische Probleme sind nunmal nicht sexy. Sie zeigen uns unsere Schwächen auf. Sie lassen uns darüber nachdenken, dass das Leben für unser Gegenüber ganz anders aussehen kann, als es auf den ersten Blick erscheint. Das kann der Freund sein, der sich mit seiner chronischen Erkrankung herumschlägt. Das kann die Freundin sein, die in ihrer Abschlussarbeit prokrastiniert und von der keiner weiß, dass sie gegen ihre Depressionen kämpft. Oder der Mensch, der doch gerade noch jede Woche in diesem Café in der Ecke saß und plötzlich weg ist. Diese Geschichten zeigen uns aber auch, dass wir jeden Moment umarmen müssen. Das mag naiv und rosarot klingen, es ist aber eine sehr sinnvolle Herangehensweise an das Leben.
Selbsthilfe betrifft jeden
Mit Themen wie Burnout, chronischen Erkrankungen, dem Tod beschäftigen wir uns aber erst, wenn wir in irgendeiner Form selbst betroffen sind. Wenn jemand im Freundeskreis eine lebensverändernde Diagnose erhält. Wenn ein Freund in eine psychische Krise gerät. Wenn ein Familienmitglied unsere Hilfe braucht. Oder wenn wir selbst diese Person sind. Für uns war damals schnell klar, dass es nicht ausreicht, einfach „schöne“ Geschichten zu schreiben. Wir wollten unsere Leser erreichen. Denn wir wussten, dass die erste Reaktion auf Selbsthilfe in unserem Magazin sein würde „Dafür bin ich noch zu jung. Was geht mich das an?“.
In Form eines World Cafés haben wir mit Schülern der Gymnasialstufe der Richard-Müller-Schule in Fulda über Burnout gesprochen. Den ersten wirklich großen Stressmoment, die Abschlussprüfungen, schaffen die meisten noch gut. Aus den Gesprächen mit der Beratungsstelle der Hochschule Fulda wussten wir aber, dass die Sorgen und Probleme im ersten Semester dann plötzlich auf sehr viele junge Leute einprasseln. Diesem Punkt mit einer solchen Veranstaltung vorzugreifen, zu zeigen, wo es Hilfe gibt, war eine nachhaltige Herangehensweise.
Erfolg auf den zweiten Blick
Selbsthilfegruppen leiden oft unter dem Image, dass ihnen so anhaftet. „Hallo, ich bin der X, und ich habe ein Problem.“ Doch sie erfüllen eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft. Sie sammeln Wissen über Hilfsmöglichkeiten. Sie bringen Menschen zusammen, zeigen ihnen, dass sie nicht allein sind. Helfen, indem sie einen Ort schaffen, an dem man sich seinen Gefühlen stellen kann, ohne Angst zu haben.
Etwa 1,5 der inzwischen drei Jahre des Projektes habe ich als Leiterin der Themenwelt mitgestaltet. Und auch, wenn man den Erfolg, den Wert des Projektes nicht direkt in Leserzahlen, neugegründeten Selbsthilfegruppen und Lobhudeleien messen kann, war für uns doch spürbar, dass wir ankommen. Es kam nicht selten vor, dass ich an unseren Partnerschulen auf Themen aus diesem Bereich angesprochen wurde, dass mir Protagonisten erzählten, dass Freunde und Bekannte auf sie zugekommen seien, oder dass ich bei ganz anderen Recherchen auf Menschen stieß, die mir erzählten, dass eine Geschichte, ein Schicksal, sie zum Nachdenken gebracht habe.
Mit diesem Projekt hat die Medienmarke move36 in meinen Augen gezeigt, welche Verantwortung Medien tragen können. Sie hat auf sehr sensible Art Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt, das so wichtig ist. Es hat aber auch dazu beigetragen, Selbsthilfegruppen zu zeigen, dass sie sich nicht verstecken dürfen. Ihre Themen offen anzusprechen, hilft so vielen Betroffenen, sich auch zu trauen, sich Hilfe zu suchen. Ich hoffe, dass dieses Projekt kein einmaliges bleibt.
Ein kleiner Einblick in „Wir müssen reden!“
- In der Recherche am meisten berührt hat mich sicherlich unsere Geschichte zum Thema Borderline.
- Was trans* ist, habe ich mir von drei jungen Menschen erklären lassen.
- Die wundervolle Lea Widmer hat mich an die Hand genommen und mir gezeigt, wie Fulda aussieht, wenn man eine Sehbehinderung hat.
- Jana Crämer zeigt mit ihrem Buch „Das Mädchen aus der ersten Reihe“ und ihren Kanälen vielen Menschen mit Essstörungen, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und Hilfe anzunehmen. Sie hat mir erklärt, was Binge Eating ist und wie sie einen Weg gefunden hat, damit umzugehen.
- Mario Dieringer pflanzt mit Trees of Memory Erinnerungsbäume für Menschen, die ihrem Leben eine Ende gesetzt haben und deren angehörigen. Seinen eigenen Weg hat er für mich skizziert.
- Über unser World Café zum Thema Burnout haben wir auch im Magazin berichtet.
- In unserem Podcast „Radio36“ aber auch im Magazin haben wir mit dem Selbsthilfebüro Osthessen darüber gesprochen, wie Selbsthilfe wirklich aussieht.